Ende Dezember stellen auch kubanische Universitäten für die sogenannten „fin de año“ (Jahresende)-Ferien den Unterrichtsbetrieb für zwei Wochen ein. In dem für uns derzeit fernen Europa sind das normalerweise die Weihnachtsferien, welche auf die stressigste Konsumzeit des Jahres folgen. Diese Hoch-Zeit des Konsumismus geht interessanterweise mit der besinnlichen, spirituell-religiösen Adventszeit einher. Wer auf die Idee kam, die Bevölkerung der kapitalistischen Länder jeden Dezember einer derartigen Widersprüchlichkeit auszusetzen, ist mir bis dato unbekannt. Fest steht jedoch, dass der Dezember mit der ihm auferlegten Adventszeit ein schwerer Monat für viele Menschen ist, die sich diese prunkvolle Besinnlichkeit nicht leisten können. Und nicht nur für diese, auch für eine Menge anderer Menschen stellt das aufgebauschte Eins-Sein mit seiner Familie, sich selbst und seinem Umfeld eine emotionale Überforderung dar. Das kontradiktorische Fest des Konsumismus, welches ursprünglich mal das höchste Fest des Christentums darstellte, steckt offensichtlich in einer komplexen Verstrickung mit fetischhaftem Komsumverhalten und kapitalistischer Perversion.
Auf der sozialistischen Karibikinsel konnte uns dieser Weihnachtstrubel mit seiner facettenreichen Dramatik zu unserer Freude nicht erreichen. Unser Dezember war sonnig und entspannt, getragen von schönen Begegnungen, Festen und allerlei Proyecto-Wirbel. Hier und da stieß man gelegentlich auf einen aufgeblasenen Weihnachtsmann – manchmal sogar mit ein paar Rentieren – aber das wars auch schon. Niemand kam zu uns, um sich über obligatorisches Schenken auszutauschen. Was aber durchaus manchmal vorkam, war, dass Kellner*innen Weihnachtsmützen trugen. Auf die anfängliche Irritiertheit, die immer auf den Anblick folgte, begann es in meinem Hirn zu rattern, bis mir wieder einfiel, dass allá (dort) – wie Kubaner*innen oft sich auf Europa beziehend sagen – ja bald Weihnachten ist.

Für mich und meine beiden Freundinnen ging die Reise nach Varadero, Trinidad und Cienfuegos. Die Impressionen, die ich gemeinsam mit den beiden sammelte, brachten mich anderen kubanischen Realitäten näher, die ich so von Havanna und noch viel weniger von der Cujae (unserer Uni) oder der Isla de la Juventud kannte. Während die Strände dem versprochenen Karibikzauber, zumindest bei schönem Wetter, auf jeden Fall gerecht wurden, empfand ich, dass der Tourismus die Authentizität Kubas an vielen Orten zerfrisst. Der Tourismus, der für Kuba eine der wichtigsten Einnahmequellen darstellt, hat spürbar auch negative Effekte auf das Land und seine Bevölkerung. Das ist in Kuba natürlich keine Neuigkeit, aber es selbst zu erleben und so auch zu verstehen, was man als normale Touristin von Kuba mitbekommt, war für mich spannend und mitunter bitter.
Was mich mit am meisten betroffen gemacht hat, war die Vielzahl sehr gebildeter Kubaner*innen, welche statt ihren Ingenieur- und Lehrerberufen einer lukrativeren, aber recht trivialen Arbeit im Tourismussektor nachgehen. Einige, mit denen ich mich etwas näher ausgetauscht habe, erzählten mir, dass sie ihre ursprünglichen Berufe sehr vermissen würden, aber aus finanziellen Gründen zumindest für eine gewisse Zeit in diesem Sektor arbeiten müssten. Andere hatten weniger Wehmut und wurden vom Geld, dass durch die Hände der Tourist*innen ins Land fließt bereits dermaßen vereinnahmt, dass sie auf mich wie lefzende Hunde wirkten, die jeden Idealismus beiseitegelegt haben. Schmerzhaft wurde mir bewusst, dass das Geld auch auf viele Kubaner*innen wie ein Genmodifikator wirkt. Der Tunnelblick dieser Kubaner*innen schweift dann auf den wunderbaren sozialdemokratischen Kapitalismus Nordeuropas, auf die freie Marktwirtschaft und unsere hohen Löhne und schönen Autos ab. Verträumt blicken sie auf unsere Möglichkeit, zu reisen und unsere grenzenlos (vogel)-freien Leben. Natürlich ohne zu erkennen, dass diese Freiheit etwas Sklavenhaftes mit sich führt und strikt an Geld gebunden ist. Die Freiheit von Kaufentscheidungen mit der Freiheit von Lebensentscheidungen verwechselnd.
Anhand meiner Erlebnisse wird ersichtlich, dass die 1960 von dem damaligen Mitarbeiter des US-Außenministeriums Lester Mallory ausgearbeitete imperialistische Strategie gegen Kuba mitunter seine Wirkungen zeigt. Das immer noch auf der Homepage des US-Außenministeriums zu findende Statement Mallorys lautet „… Die einzige absehbare Möglichkeit, um ihnen [der Regierung] die Unterstützung im Inland zu nehmen, ist aufgrund wirtschaftlicher Mängel und von Elend, Enttäuschung und Unzufriedenheit hervorzurufen (…). Deshalb muss Kubas Wirtschaftsleben mit allen Mitteln geschwächt werden (…), Kuba müssen Geld und Lieferungen verweigert werden, damit die Real- und Nominallöhne sinken, mit dem Ziel, Hunger, Verzweiflung und den Sturz der Regierung hervorzurufen.” Dass diese seit nunmehr 60 Jahren angewandte kriegerische Taktik auch seine Erfolge zeigt, ist durchaus nachvollziehbar.
Kommt man mit den Kubaner*innen ins Gespräch, sich als etwas fachkundiger als ein*e normale*r Tourist*in entpuppend und auf die Aussage, die Regierung sei an allem schuld konternd „Y el bloqueo?“ (Und die Blockade?), dann kann ein Gespräch auf Augenhöhe beginnen. Meistens gibt es danach zwei mögliche Verläufe dieses Gesprächs. Ein Teil der Gesprächspartner*innen atmet erleichtert auf und ein anderer Teil zuckt augenverdrehend die Schultern. Letztere sind es leid, dass diese felsenfest erscheinende Blockade schuld an ihrer Situation ist, lieber suchen sie die Schuld an ihrer Situation in etwas, was ihnen leichter zu verändern scheint als die Blockade und das ist dann oft die Regierung oder der Sozialismus. Irgendwann empfand ich es dann zugegebenermaßen als ziemlich mühsam, diese Kubaner*innen davon zu überzeugen, dass sie große Vorteile aus ihrem System ziehen, deren Ausmaß ihnen wohl nicht ganz bewusst ist. Auch darauf zu beharren, wie wichtig eine Aufhebung der völkerrechtswidrigen Wirtschaft, Handels- und Finanzblockade für die Erhöhung der tatsächlich sehr niedrigen Löhne und ein Aufatmen der Wirtschaft wäre, war irgendwann ermüdend. Trotzdem ist es wichtig, dass sie merken, dass sie nicht jede*r Touristin alles aufschwätzen können, sondern dass es auch Leute gibt, die sich für Kuba und seine Lage interessieren und einsetzen. Im besten Falle, beginnen sie allerdings nochmal an ihrer eigenen Fehleranalyse zu arbeiten.
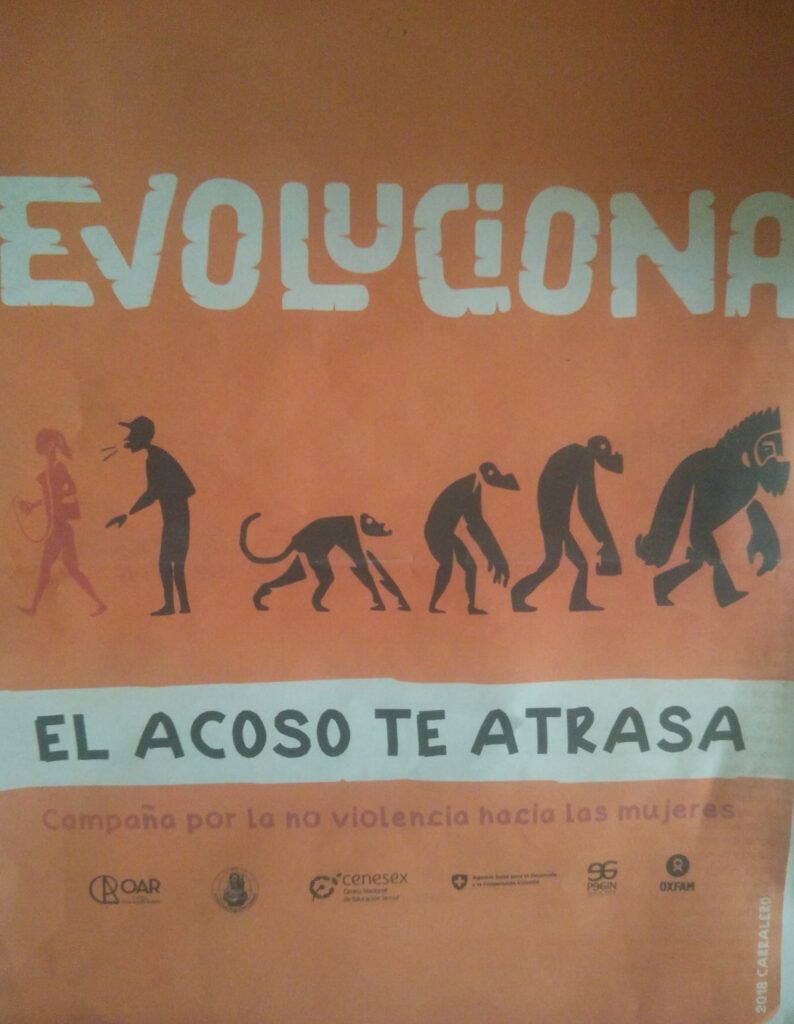
Was noch mehr zu meiner Verwirrung beitrug, war die widersprüchliche ideologische Entwicklung meiner selbst und der Außenwelt. Während mir durch die Lektüre von Volker Hermsdorfs „Fidel Castro“ die Errungenschaften der Revolution vergegenwärtigt wurden und ich mit historischen Ereignissen in und um Kuba, in der Lebenszeit Fidel Castros überspült wurde, drang von außen eine zunehmende Abwendung von dieser Revolution an mich heran, welche natürlich mit einem gewissen Geschichtsunbewusstsein bei den entsprechenden Träger*innen dieser Haltung einherging. Ob meine Erlebnisse ein repräsentatives Bild der gegenwärtigen Situation in Kuba aufzeigen, möchte ich jedoch offenlassen. Fest steht, dass der kontradiktionsreiche Weg des Aufbaus des Sozialismus für Kuba weitergeht und für uns alle eine Herausforderung darstellt, der man sich auch in den Ferien nicht entziehen kann.
Das ist ein Artikel von Johanna.
… dass Ernesto Che Guevara und Fidel Castro den lateinamerikanischen Machismo überwunden hätten, scheint mir leicht übertrieben – selbst in den ikonographischen Darstellungen der beiden schimmert er wenig verschämt durch … Nebenbei bemerkr: Politik ist ein abgeleiteter Bereich, der den Alltag überwölbt, aber nur wenig beeinflusst. Im Alltagsverhalten schimmern jahrhundertealte Praktiken durch. Wer an die Verhaltensweisen in den ehemals realsozialistischen Ländern denkt, z.B. Schwulenjagd in Polen oder Russland, hat eine Idee davon, wie oberflächlich politische „Strukturen“ sitzen.